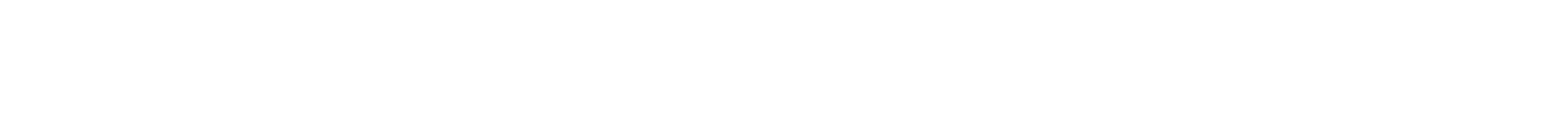Überblick
Als die junge Journalistin Cleo Sander den Auftrag erhält, über das populäre AR-Game „Hidden Space“ zu berichten, ahnt sie nicht, worauf sie sich einlässt. Ihre Recherche führt sie schnell hinter die schillernde Fassade des Spiels und in den Dunstkreis des Scio-Kartells, einer skrupellosen Hackergruppe. Jeder neue Kontakt, jede Information zieht sie tiefer in einen Strudel aus politischer Korruption und digitaler Überwachung. In diesem düsteren Neo-Noir-Thriller verschwimmen die Grenzen zwischen Jäger und Gejagter, während Cleo versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, bevor sie selbst im Verborgenen verschwindet.| Produktion: | Rosenberg Entertainment e.K. |
| Regie: | Fabian Rosenberg |
Stills
Einordnung
Die visuelle Sprache von „Hidden Space“ ist von einer grundlegenden Dichotomie geprägt, die den thematischen Kern des Films spiegelt: die sterile, kontrollierte Welt der Institutionen gegenüber der chaotischen, unberechenbaren Unterwelt. Die Szenen in der Redaktion und im politischen Kontext wurden bewusst mit einer ruhigen, oft statischen Kamera eingefangen. Eine kühle, fast aseptische Farbpalette unterstreicht hier die vermeintliche Objektivität und Ordnung. Demgegenüber steht die Welt des Scio-Kartells, die durch eine organische, fast fiebrige Unruhe der Handkamera charakterisiert ist. Die Kamera wird hier zum subjektiven Begleiter der Protagonistin und überträgt ihre wachsende Paranoia und den Kontrollverlust direkt auf den Zuschauer.
Um diesen Look zu realisieren, wurde auf eine cinematische Ästhetik gesetzt, die durch den Einsatz klassischer Linsen mit charaktervoller Abbildungsleistung – inklusive weicherem Bokeh und subtilen Flares – eine visuelle Wärme erzeugt, die im Kontrast zur kalten, digitalen Thematik steht. Die Lichtsetzung folgt konsequent den Prinzipien des motivierten Lichts; reale Lichtquellen wie Lampen, Bildschirme und Straßenlaternen definieren die Szenerie. In den düsteren Konfrontationen wurde gezielt mit Negativfüllung gearbeitet, um nach den Prinzipien des Chiaroscuro harte Schatten zu formen, die die Protagonistin isolieren und die allgegenwärtige Bedrohung visuell verdichten.
Stilistisch ist das Projekt eine Hommage an den Neo-Noir und den Verschwörungsthriller, dessen visuelle Paranoia in die heutige Zeit transferiert wird. Die Kamera ist nicht nur passiver Beobachter, sondern ein aktives Werkzeug des Storytellings, das die emotionale Reise der Hauptfigur nachzeichnet. Die Bildsprache wird so zur Metapher für den zentralen Konflikt des Films: den Kampf des Individuums gegen ein unsichtbares, übermächtiges System in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und digitalem Raum längst zerfallen sind.